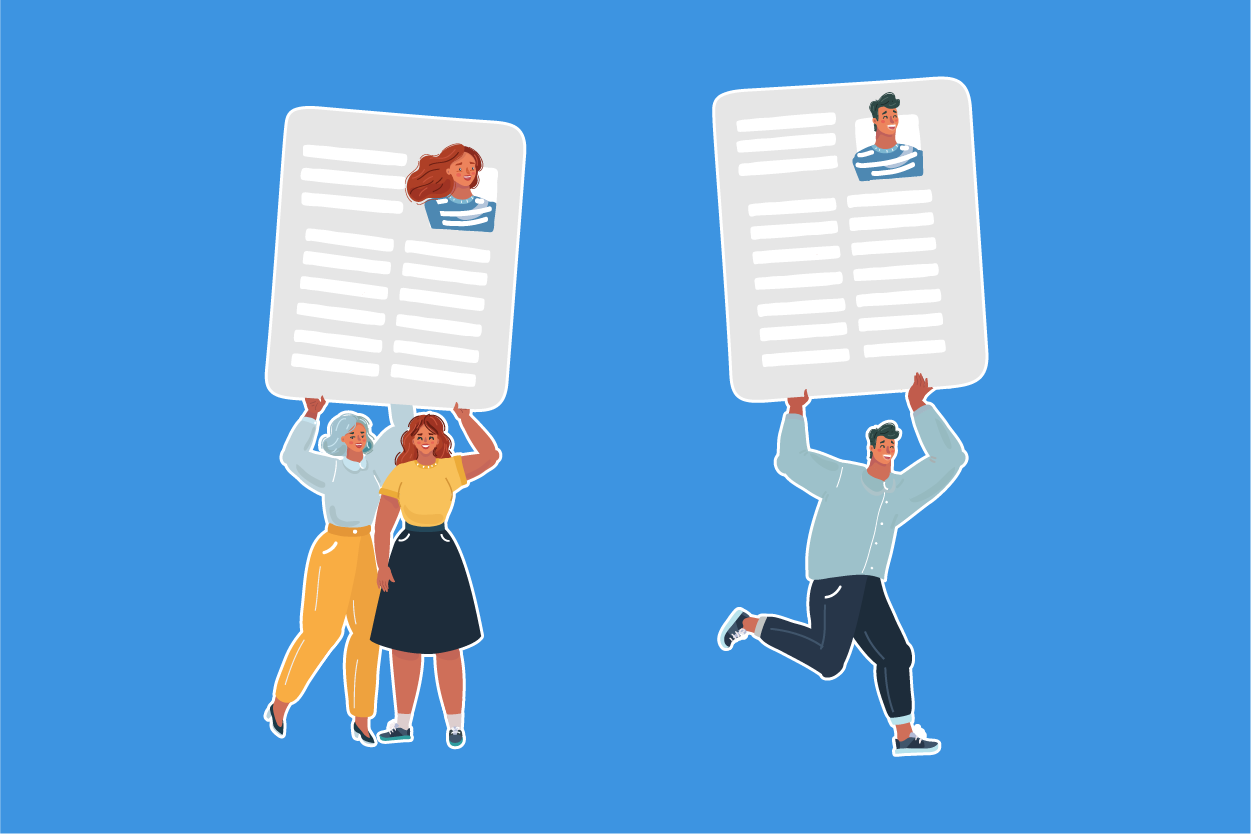Verantwortung teilen, Gemeinschaft leben
Der kommissarische Schulleiter Daniel Schimmer und sein Stellvertreter Markus Michalski über die Verantwortungsgemeinschaft, neue Lernräume und warum kooperatives Lernen und partizipative Schulentwicklung an der Goethe-Gemeinschaftsschule Kiel gelebte Realität sind.
Seit 2010 gehört Markus Michalski zum Schulleitungsteam der Goethe-Gemeinschaftsschule Kiel – inzwischen als stellvertretender Schulleiter. Vor zwei Jahren übernahm Daniel Schimmer die kommissarische Leitung der Schule mit rund 400 Schülerinnen und Schülern sowie 60 Mitarbeitenden. Gemeinsam sprechen sie über ihre Vision für die Schule, neue Raumkonzepte, Verantwortung im Kollegium und die Frage, welche Kompetenzen junge Menschen wirklich für ihre Zukunft brauchen.
Was bewegt die Goethe-Gemeinschaftsschule aktuell?
Markus Michalski: Das Thema Verantwortung ist ein wesentlicher Baustein unseres Schulalltags. Wir wollen Verantwortung für die Entwicklungen übernehmen. Und da haben wir durch den Zuwachs durch Daniel Schimmer einen ordentlichen Schub erhalten. Das finden wir super und versuchen, an vielen Stellen nicht einfach nur Akzente zu setzen, sondern Pflöcke einzuschlagen, die unseren Weg als Schule weisen. Ein kleines Team trifft die Vorbereitung, das große Team trägt das Ganze und setzt um.
Daniel Schimmer: An unserer Schule bilden wir eine Verantwortungsgemeinschaft, in der jeder Verantwortung für den Erfolg der Schule mitträgt. Jedoch ist zugleich nicht jeder für alles verantwortlich. Das ist ganz wichtig. Ich glaube daran, dass jede Schule ein bestimmtes Credo für sich festlegen sollte. Bei uns kreist dieses um Verantwortung und Gemeinschaft.
Wie hat sich die Rolle der Schulleitung verändert?
Daniel Schimmer: Zu den Werten Verantwortung und Gemeinschaft gehört auch, dass die Schulleitung Abschied nehmen muss vom Mikromanagement. Schulen sind dahingehend historisch geprägt und funktionieren nach wie vor häufig top-down. Davon muss in gewissen Bereichen, nicht in allen, deutlich Abstand genommen werden. Doch wie schaffen wir es, Menschen Verantwortung zu übertragen? So etwas kann zum Beispiel über die Leitung bestimmter Gremien von Kolleginnen und Kollegen geschehen, die wiederum die gesamte Schulentwicklung im Blick haben. Wir konnten bereits bei einigen Entwicklungen große Erfolge verbuchen, wenn Kolleginnen und Kollegen große Verantwortungsbereiche zugesprochen wurden, beispielsweise in Sachen Präventionsbereiche, wo es darum geht, für die Kinder ein besonderes Umfeld zu schaffen. Oder bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wenn die Menschen spüren, dass sie wichtige Schulbausteine mittragen und ihr Engagement etwas bewirkt, ist das sehr wertvoll und erfolgreich. Für mich bleibt dann eine sehr schöne Aufgabe übrig, nämlich diese Entwicklungen transparent zu machen, immer wieder an bereits erlangte Erfolge zu erinnern und den Menschen Zugänge zu diesen Erfolgen zu ermöglichen. So hängt im Lehrerzimmer ein Kanban-Board, auf dem die verschiedenen Prozesse dargestellt sind. Und da steht auch ganz offensiv acht Wochen vor Schuljahresende: ‚Es wird eigentlich Zeit für eine Fete‘.
Markus Michalski: Und klar, manche Entscheidungen machen neue Baustellen auf. Dann gehen wir aufeinander zu. Das ist ein richtig guter Prozess. Und welche Erfolge wir in den letzten zwei Jahren in Sachen Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung feiern konnten und welche Unterrichtsumgebungen wir kreieren konnten, die es ermöglichen, mit Lernenden kooperativer und stärker in den Austausch zu gehen, das ist schon beachtenswert.
Welche zukunftsweisenden Entwicklungen wurden in letzter Zeit angeschoben?
Daniel Schimmer: Dazu gehören auf jeden Fall die entstandenen Differenzierungsflächen, die das kooperative Lernen ermöglichen. Das heißt, wir verabschieden uns in bestimmten Bereichen von der klassischen Sitzordnung. Das hilft dabei, Unterricht anders und flexibler zu denken. Zweitens die Verantwortungsgemeinschaft und drittens die Vision ‚Goethe 2030‘. Diese Vision versteht sich als großes Sammelbecken dafür, unsere Schule bis 2030 als einen Ort der Entwicklung zu verstehen. Und dass wir bis dahin wissen, wir können uns immer in alle Richtungen entwickeln, weil wir gut sind.. Die Lehrkräfte haben alle fünf Jahre Lehramt studiert, ihre Fächer und zusätzlich Pädagogik, Fachdidaktik und Psychologie. Zudem haben sie eineinhalb Jahre das Referendariat abgeleistet, also sechseinhalb Jahre Ausbildung hinter sich. Unser Vertrauen in die Lehrkräfte ist groß, auch deshalb, weil sie so gut ausgebildet sind.
Immer mehr Schulen wollen – wenigstens teilweise – weg vom Frontalunterricht. Wie gestaltet sich das an Ihrer Schule?
Daniel Schimmer: Unser Anspruch ist es, zunächst die passenden räumlichen Gegebenheiten herzustellen, um mehr selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen. Ziel ist nicht, dass jeder machen kann, was er will, denn gerade die Kleinen brauchen Anleitung. Lernen muss gelernt werden. Erst gestern saßen wir mit der betreffenden Firma vor den Entwürfen für einen Raum, der die Möglichkeit des kooperativen Austausches schafft. Beispielsweise durch Couch-Systeme – nicht zu verwechseln mit der Couch zuhause. Breite Systeme mit der Möglichkeit, digitale Endgeräte abzustellen, Stehtische mit und ohne Hocker, sowie klassische Elemente. Auch die Farbwahl soll die Lernatmosphäre unterstützen. Die Herausforderung dabei ist: man muss die Kinder ein bisschen laufen lassen. Das fällt einigen Lehrkräften schwer und neue Räume eröffnen auch neue Baustellen – beispielsweise Stichwort pädagogische Prävention. Der Schools-that-care-Prozess hat unsere Schule 10.000 Euro gekostet und soll zur verbesserten Gesundheit der Kinder führen. Kinder, die besser unterstützt werden, werden auch sozial und emotional seltener auffällig im Unterricht.
Markus Michalski: Die neuen Räume schaffen die Möglichkeit, dass jeder sich nach seinem aktuellen Befinden platzieren kann. Ob er nun verkehrt herum auf dem Stuhl sitzen möchte, sich zurückziehen will oder mit einer Gruppe an einen großen Tisch setzen möchte, weil er den Austausch braucht, um sich erfolgreich mit Materialien beschäftigen zu können. Der Weg zu solchen Räumen ist nun eingeschlagen und wird sukzessive ausgebaut.
Daniel Schimmer: Um mal die Dimension aufzumachen, was das kostet. Die Ausstattung eines solchen Raumes kostet ungefähr so viel wie unser kompletter Schuletat für ein ganzes Kalenderjahr. Es ist eine tolle Aufgabe, eine Schule entwickeln zu dürfen. Ich habe das jahrelang von der anderen Seite gemacht und vom Ministerium aus Schulen evaluiert und beraten. Wieder ins operative Geschäft einzutauchen, ist spannend, weil man mitgestalten kann. All diese Entwicklungen haben auch positive Auswirkungen auf die Berufsorientierung. Ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Lernlandschaften in den nächsten Jahren weiter auszubreiten, können wir für die Schülerinnen und Schüler bessere Anknüpfungspunkte an die neue Berufsrealität schaffen. Die 21st-Century-Skills, die heutzutage von den jungen Menschen erwartet werden, sind ganz anders als zu unseren Zeiten. Ich erinnere mich an mein Bewerbungsgespräch bei einer Bank mit sechzehn. Das Wichtigste war, dass der Anzug saß. Wenn du heute in Bank gehst, ist das Wichtigste, dass man mit den verschiedenen Kunden zurechtkommt, das Portfolio praktisch erläutern kann und vor allem empathisch zu sein. Das sind alles Fähigkeiten, die kann man erfolgreich lernen, wenn man in der Schule schon gezwungen ist, kooperativ mit den Mitmenschen in Verhandlungen zu gehen, eine kooperative Haltung zu entwickeln.
Worauf kommt es heute in Sachen Berufsorientierung an?
Markus Michalski: Das reine fachliche Wissen darf nicht vernachlässigt werden, aber die Priorität darf eben nicht mehr nur darauf liegen. Die Skills, die heute gebraucht werden, sind nicht nur das Fachwissen, das sieht man auch bei den Bewerbungsgesprächen, dass oft Auftreten wichtiger ist als die Noten.
Daniel Schimmer: Das ist ein Generationsding. Schon meine Lehrkräfte meinten immer, vor fünf Jahren konnten die Schüler noch dieses und jenes. Es ist tatsächlich so, dass sich bestimmte Fähigkeiten verschoben haben. Schüler von heute können andere Dinge als früher. Aber sie sind auch mit Entwicklungen konfrontiert, die bei uns keine Rolle spielten. Ich finde die Herausforderung für Jugendliche, mit den Informationen rund um Social Media umzugehen, enorm. Spätestens in der Sekundarstufe ist die Konfrontation voll da. Dieses Spannungsverhältnis von Selbstdarstellung, Informationsbeschaffung und Informationsselektion führt bei vielen zu Überforderung. Wir müssen immer schauen, wie bist du diesen Informationen ausgesetzt und was können wir für dich tun, damit du mit ihnen besser umgehen kannst. Genau in diesem Bereich sind wir als Schule gefordert und laut Schulgesetz für Bildung und Erziehung zuständig. Zur Erziehung gehört auch, die Kinder resilient zu machen gegenüber dem, was ihnen auferlegt wird von dieser Welt.
Markus Michalski: Und deshalb sind auch so Workshops wie ‚WE ARE OCEAN Blaupause Kiel‘ so wertvoll, eine Kollaboration von ARTPORT_making waves und der Goethe Gemeinschaftsschule Kiel (unter der Leitung von Frau Frädermann), dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel Marine Science der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel sowie dem ozean:labor der Kieler Forschungswerkstatt und dem spce | Muthesius. Bei dem Workshop ging es darum, wie wir Menschen gemeinsam den Ozean gestalten können, den wir alle brauchen – wie wir Bereiche schützen können, aber auch nachhaltig bewirtschaften. Denn auch diese Themen beschäftigen die Kinder heute viel mehr als früher.
Ab August greift das Handy-Verbot an Schulen bis zur Klasse 9. Was kommt auf Sie zu?
Markus Michalski: Eigentlich ist es ganz schön, dass es ab jetzt keine unterschiedliche Handhabung je nach Schule mehr gibt, denn das erspart Diskussionen.
Daniel Schimmer: Das ist ab jetzt ja ganz klar geregelt und trotzdem ähnlich der Vorschrift, die bei uns galt. Wir haben einen Auftrag: Die Kinder zu schützen. Der private Gebrauch der Mobiltelefone ist nicht nötig, wir sind digital zunehmend gut aufgestellt. Digitale Kompetenzen werden professionell aufgebaut – dafür brauchen die Lernenden einen sicheren Raum, den können wir jetzt noch besser darstellen. Gepaart mit einer starken schulischen Prävention gehen wir den richtigen Weg.
TEXT Markus Till, Kristina Krijom
FOTO Mubarak Bacondo
So geht Berufsorientierung
Eine korrekte und aussagekräftige Bewerbung ist der erste Schritt auf dem Weg in die Ausbildung. In unserem Servicebereich steht außerdem, wie man die nachfolgenden Herausforderungen in Vorstellungsgespräch, Assessmentcenter und dem Start ins Arbeitsleben erfolgreich meistert.